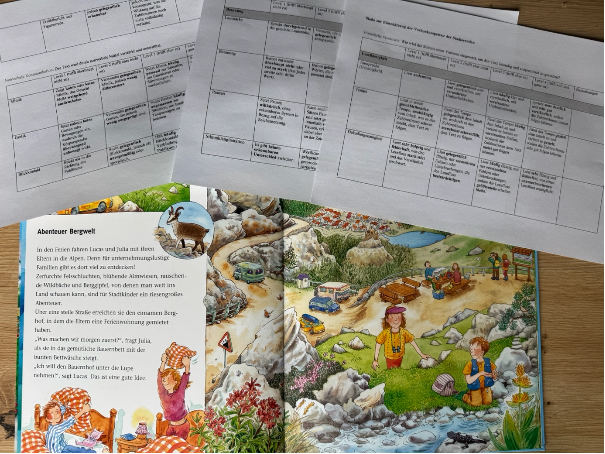Von Marie Winkler
„Das Vorlesen an der Schule hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch die Kinder waren begeistert“, so eine Studentin in der Reflexionssitzung. Das Seminar „Vertiefte Grundlagen zur Leseförderung“ von Prof.´in Dr. Juliane Dube verfolgt ein ambitioniertes Ziel: Es stattet zukünftige Grundschullehrkräfte nicht nur mit theoretischem Wissen über Lesekompetenz aus, sondern bereitet sie zugleich methodisch und praktisch auf die anspruchsvolle Aufgabe der Leseförderung vor. Angelehnt an zentrale Inhalte der Einführungsvorlesung zur Lesekompetenz vertieft das Seminar intensiv fachdidaktische Konzepte und legt einen besonderen Fokus auf das Vorlesen als unterrichtlichen Kern. Am Ende des Seminars, in der vorletzten Semesterwoche, zeigt sich, was die Student*innen gelernt haben und wie sie dieses Wissen praktisch ausüben. So wurde sich in mehreren Sitzungen mit dem dialogischem Lesen beschäftigt. „Dies ist eine gute Methode, die ich als wichtiges Element im Unterricht sehe“, so Tabea.
„Es wurde individuell geübt und immer wieder im Seminar vorgelesen. Ein guter Mix aus Theorie und Praxis ist wichtig“, so Dube. Bereits vor der ersten Sitzung nahmen sich die Studierenden selbst beim Vorlesen auf und erhielten eine individuelle Rückmeldung zu Stimmeinsatz und Ausdruck. Dabei wählten sie zwischen verschiedenen Geschichten wie „Mäuse wie wir“ oder „Der Dachs hat schlechte Laune“ aus. „In den ersten drei Sitzungen lernen die Studierenden Methoden zum richtigen Vorlesen kennen“, erklärt Frau Prof.´in Dube. „Wie man sich in Figuren hineinversetzt, die Stimme variiert und mit Gestik und Mimik arbeitet.“ Dieser Einstieg schärft das Bewusstsein für die Bedeutung paraverbaler und nonverbaler Elemente im Vorleseprozess. Unter „paraverbal“ versteht man den Tonfall oder Stimmlage, also wie etwas gesagt wird. „Nonverbal“ bedeutet die Körpersprache, Mimik oder Gestik.
Die Student*innen müssen nach der dritten Sitzung eine zweite Aufnahme abgeben. Auch hier gibt Frau Prof.´in Dube eine ausführliche Rückmeldung. „Bei vielen bemerkt man einen Unterschied bei der zweiten Aufnahme“, so Dube, „man muss noch individuell Rückmeldung geben, damit jede Emotion beim Vorlesen spürbar wird.“ Auch die Student*innen äußern sich positiv zu den Aufzeichnungen. „Man hat sich vorher nicht so viele Gedanken gemacht, ob man richtig vorliest. Erst durch den Theorieteil hat man mehr darauf geachtet“, so eine Studentin während des Seminars.
„Dass es auf die Betonung und das Hineinversetzen in die Charaktere ankommt, dies war für mich ein Aha-Moment“, berichtet Studentin Madeleine. „Dann kommt das Lesen ganz anders rüber und den Kindern macht es mehr Spaß zuzuhören.“ Die Studierenden wenden das Gelernte sowohl im Seminar selbst als auch vor Kindern in Schulen an. Das Vorlesen an den Schulen in Gießen und im Umkreis hat Frau Prof.´in Dr. Dube vermittelt. Zu zweit gehen die Studierenden an einen interessierten Praxisort, wie zum Beispiel die Burgschule in Großen-Linden. Dort liest ein*e Student*in aus einem selbstgewählten Bilderbuch, wie „Peterson und Findus“, vor und nutzt die gelernten Methoden aus dem Seminar. Am Ende des Unterrichts erhalten die Student*innen ein Feedback der Lehrkraft und den Schüler*innen.
Doch auch neue Ansätze wie das dialogische Lesen oder Tandemlesen wurden besprochen. Beim dialogischen Verfahren wird ein Gespräch über das Buch geführt. Der Erwachsene unterstützt durch gezielte Fragen und Kommentare und ermutigt so das Kind, selbst über die Geschichte zu sprechen. Beim Tandemlesen lesen zwei Personen – meist ein*e stärkere*r Schüler*in (Tutor*in) und ein*e schwächere*r (Lernende*r) – gemeinsam denselben Text parallel und synchron laut. Ziel ist es, die Lesegenauigkeit, -geschwindigkeit und -sicherheit des*r Schwächeren zu verbessern. „Es war mir wichtig, verschiedene Möglichkeiten mit einzubringen: Praxis, Methoden, Differenzierung“, so Dube. „Man muss seine Emotionen zeigen und mit Gestik und Mimik arbeiten.“ In den Sitzungen üben die Student*innen meist in Partnerarbeit. Hier gehen sie auf die Flure und wenden die erlernten Methoden an weiteren Beispielen an. Bei der Auswahl setzt Dube auch auf schwierigere Texte, zum Beispiel über Mitochondrien.
Auch die Studierenden erleben einen Lernfortschritt. „Am Anfang war es schwierig auf alles zu achten“, so Tabea. „Aber man hat viel geübt, dadurch hat man sich sicherer gefühlt.“ Besonders das dialogische Lesen heben Tabea und Madeleine als hilfreiche Methode hervor. „Das Vorlesen ist eine unterschätzte Fördermöglichkeit“, betont Juliane Dube. „Man hat die Chance, das Lesen den Kindern näherzubringen und durch richtiges Vorlesen das Interesse zu wecken.“ Die Studierenden bewerten den Mix aus theoretischem Fundament und intensiver Praxis durchweg positiv: „Wir haben sehr gute Methoden kennengelernt, die man direkt anwenden konnte.“ Das Seminar „Vertiefte Grundlagen zur Leseförderung“ vermittelt angehenden Lehrkräften praxisnahe, didaktische Kompetenzen und schärft den Blick für eine schülerzentrierte, erlebnisorientierte Leseentwicklung.